„Warum will Ihr Kind ein Smartphone?“, wollte Felix Rudolph-von Niebelschütz am 29. Oktober von seinem Publikum wissen. Der Medienpädagoge hielt einen Vortrag im Rahmen der kostenlosen Reihe „Kinder in digitalen Welten begleiten“, die Smart City Eichenzell in Kooperation mit „Menschen und Medien e.V.“ für Eltern, Großeltern und andere Erziehende anbietet. Thema des Vortrags war „Das erste Smartphone fürs Kind – was nun?!“.
„Aus den Statistiken kann ich Ihnen eines schon verraten: Üblicherweise will es Ihr Kind nicht zum Telefonieren“, so der Referent schmunzelnd. „Doch die Antwort Ihres Kindes gibt Ihnen Hinweise darauf, wobei Sie es begleiten sollten.“

Platz 1: WhatsApp
Auf Platz eins der Wunschliste stehe der Messengerdienst WhatsApp, der offiziell ab 13 Jahren genutzt werden dürfe. „WhatsApp stellt Eltern aus verschiedenen Gründen vor Herausforderungen“, sagte der Medienpädagoge. Viele Schülerinnen und Schüler kommunizierten darüber untereinander – anfangs meist mit einer Flut von Nachrichten im Gruppenchat, die Kinder auch überfordern könne. Es sei eine Gratwanderung: Verbiete man seinem Kind den Messenger ganz, schütze man es zwar davor, es könne möglicherweise aber auch von vielen Klassenthemen ausgeschlossen werden. Da Lehrer WhatsApp aus Dienstgründen nicht nutzen dürften, könnten diese ihre Klassen darin nicht begleiten. Dazu kämen der leichte Zugang zu unangemessenen Inhalten sowie der bekannte laxe Datenschutz des Anbieters Meta Platforms (früher: Facebook Inc.). Auch könnten Erwachsene, die an die Handynummer eines Kindes gelangt seien, es jederzeit über WhatsApp kontaktieren.
Rudolph-von Niebelschütz empfahl Eltern, ihren Kindern ein Vorbild zu sein und eher auf alternative sicherere Messenger wie Threema oder Signal auszuweichen. Dort könne sich das Kind in einem geschützten Rahmen ausprobieren. Wenn es doch WhatsApp sein müsse: „Begleiten Sie Ihr Kind von Anfang an darin. Sie dürfen sich als Eltern Chatverläufe anschauen und mit Ihrem Kind besprechen, was okay ist und mit wem sie chatten oder telefonieren dürfen – nur hinter seinem Rücken sollten Sie das lieber nicht tun.“ Die Kunst sei es, seinem Kind Geborgenheit und Sicherheit in der digitalen Welt zu vermitteln, ihm gleichzeitig aber auch zu erklären, bei welchen Themen man sich sorge.
Platz 2: Instagram
Das soziale Netzwerk Instagram sei vor allem bei älteren Kindern ab der Pubertät beliebt, wo soziale Kontakte immer wichtiger würden. Erlaubt sei es ab 13 Jahren. „Die größte Herausforderung hierbei ist, dass Kinder auf Inhalte stoßen können, die für sie nicht geeignet sind“, warnte Rudolph-von Niebelschütz. Selbst Filtereinstellungen schützten nicht immer, beispielsweise seien dort extremistische Meinungen zu finden.
Platz 3: YouTube
„Wer von Ihnen ist schon einmal in YouTube-Videos versackt?“, fragte Rudolph-von Niebelschütz und hob wie die meisten im Raum die Hand. „Ob Serien, Musikvideos, Tutorials – YouTube hat ein unglaublich großes Suchtpotenzial. Wenn es uns Erwachsenen schon so schwer fällt zu widerstehen, wie können wir das von unseren Kindern verlangen?“. Essenziell sei es daher, die Nutzung von YouTube für Kinder zeitlich zu beschränken.
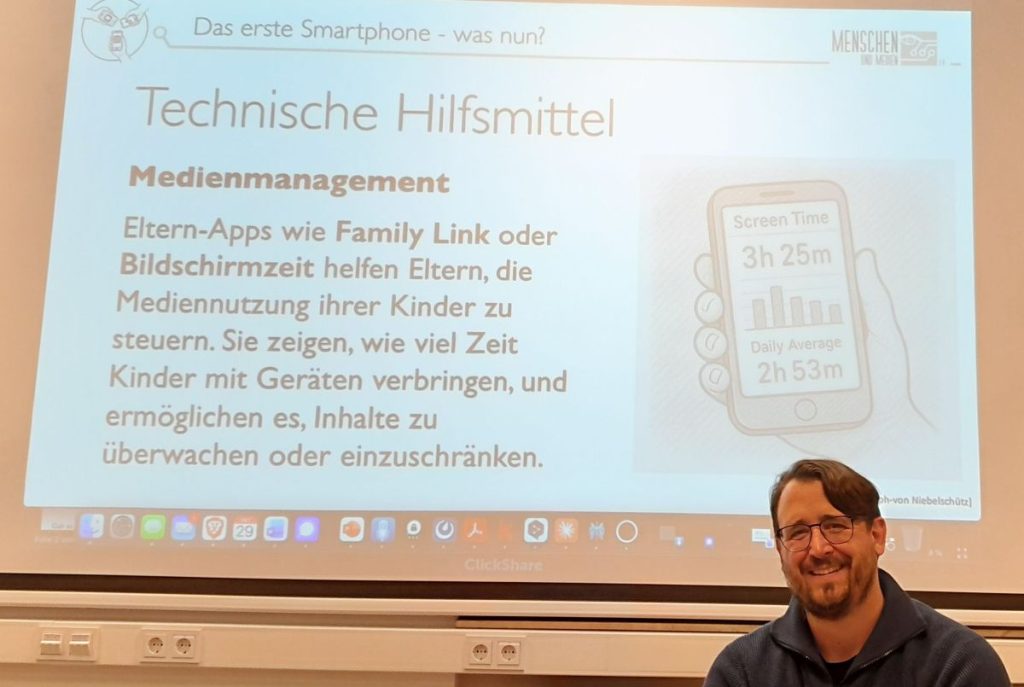
Platz 4: TikTok
Das Videoportal für Kurzvideos, das zusätzlich Funktionen eines sozialen Netzwerks beinhaltet, sei für Jugendliche interessant, weil wenige Erwachsene es nutzten. Es sei mit Zustimmung der Eltern ab 13 Jahren erlaubt. „Leider hat TikTok einen gut gestalteten Algorithmus, der den Nutzenden immer etwas Interessantes anbietet“, warnte der Referent. Auch hier sei das Suchtpotenzial hoch, viele Jugendliche selbst belaste die Zeitintensität, die die Plattform einfordere – „daher unbedingt im Rahmen der gesamten Medienzeit gesondert begrenzen.“
Platz 5: Snapchat
Snapchat ist eine Instant Messaging-App ab 13 Jahren. Das Besondere: Videos und Fotos können nur zeitlich begrenzt geteilt werden und löschen sich standardmäßig, sobald der Empfänger sie angeschaut hat. Auch der Chatverlauf lösche sich regelmäßig nach 24 Stunden. Allerdings gebe es fragwürdige Belohnungssysteme wie Flammen-Emojis, die Nutzende zum täglichen Austausch von Videos und Fotos animierten, was gerade bei Kindern einen hohen sozialen Druck erzeugen könne.
Daneben gebe es bei Kindern beliebte Spiele wie das Online-Mehrspieler-Actionspiel „Brawl Stars“. Diese Spiele arbeiteten jedoch häufig mit glücksspielähnlichen Elementen oder böten keine Schutzfilter wie Altersverifikationen, sodass auch Erwachsene Kinder kontaktieren könnten.
Gefahrenpotenziale gegenüber Kindern offen kommunizieren
Viele der vorgestellten Apps böten zwar Sicherheitseinstellungen an und beschränkten den Zugang von altersunangemessenen Inhalten für Kinder und Jugendliche – zumindest in der Theorie, so Rudolph-von Niebelschütz. Er empfahl in jedem Fall: „Legen Sie Konten grundsätzlich zusammen mit Ihrem Kind an. Wählen Sie einen unverfänglichen Benutzernamen – nicht den richtigen Namen! – und ein falsches Geburtsdatum, das aber dennoch das korrekte Alter Ihres Kindes wiederspiegeln sollte, damit die Sicherheitsfunktionen der Anbieter greifen.“ Diese beinhalteten beispielsweise, dass Kinder keine Freundschaftsanfragen erhalten könnten, oder dass die Standortfreigabe standardmäßig deaktiviert sei. Zusätzlich könne man über Jugendschutzfilter, sogenannte „black lists“ (Seiten, die das Kind nicht aufrufen kann) oder „white lists“ (Seiten, auf die das Kind zugreifen darf), das Smartphone kindersicherer machen.
Hundertprozentigen Schutz böten diese Voreinstellungen jedoch nicht, da sie teilweise zu umgehen seien: „Daher führt kein Weg daran vorbei, dass Sie mit Ihrem Kind ernsthaft, aber ohne Panikmache über den Kontakt zu Fremden im Netz, mögliche sexuelle Übergriffe, Pornografie oder Gewaltdarstellungen sprechen. Sollten Ihrem Kind doch einmal verstörende Inhalte begegnen – das können auch nur Nachrichtenclips über aktuelle Kriegsgeschehen sein – , bieten Sie sich als Ansprechpartner an, an den es sich jederzeit vertrauensvoll wenden kann.“
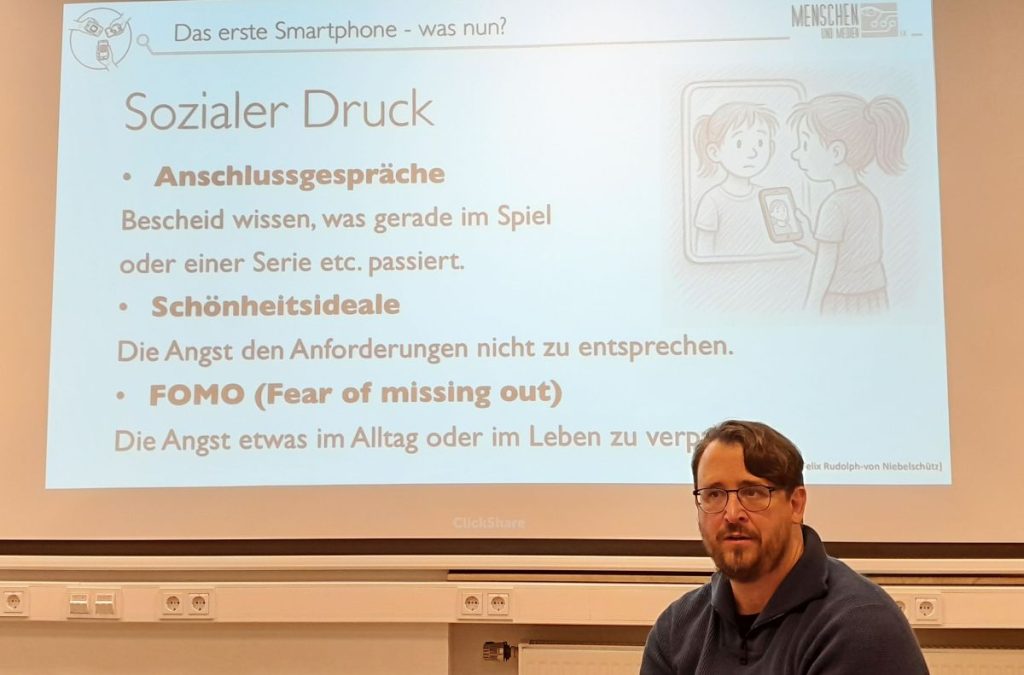
Klein anfangen, eng begleiten, schrittweise loslassen
Er riet, bei der Installation von Apps nach dem Treppenmodell vorzugehen: „Beginnen Sie mit einer App, nach der Ihr Kind ausdrücklich fragt und die Sie vertreten können, und schauen Sie sich an, wie es damit umgeht. Wenn es funktioniert, lassen Sie langsam los und signalisieren Sie Ihrem Kind, dass sie ihm in der Nutzung nun vertrauen und bereit sind, es auch andere Apps nutzen zu lassen.“ Weiterhin solle man in regelmäßigen Abständen mit seinem Kind über die Inhalte von Serien, Spielen oder Chats sprechen: „So merken Sie im Idealfall frühzeitig, wenn Ihr Kind beginnen sollte, Medien exzessiv zu nutzen. Oder Sie nehmen den Austausch mit Ihrem Kind zum Anlass, um es etwa zu gefälschten Schönheitsidealen im Netz oder der „Fear of missing out“ – den überzogenen Medienkonsum aus Angst, soziale Ereignisse und Neuigkeiten zu verpassen – aufzuklären.“
Durch handyfreie Zonen und Zeiten – etwa beim gemeinsamen Essen, während des Besuchs von Freunden oder im eigenen Zimmer – erfahre das Kind, dass es auch ohne Handy Spaß und Kontakte haben könne. Auch wenn vor allem pubertierende Kinder dies manchmal als Kontrolle oder Schikane der Eltern empfänden, plädierte Rudolph-von Niebelschütz dafür, Kinder beim Thema Medien mit wohlwollender, aber nicht nachlassender Aufmerksamkeit zu begleiten: „Selbst mein achtzehnjähriger Sohn sagt heute zu mir: ‚Danke, dass Du uns nicht alles erlaubt hast‘.“
Tipps & Tricks
- Jugendschutzfilter finden Sie unter www.klicksafe.de
- Weitere hilfreiche Links: www.saferinternet.at/privatsphäre-leitfaden; www.verbraucher.de; www. Handysektor.de; www.schau-hin.info; https://www.medien-kindersicher.de
- Füllen Sie einen individuellen Mediennutzungsvertrag mit Ihrem Kind aus (Vorlagen für verschiedenen Altersgruppen finden sich unter https://www.mediennutzungsvertrag.de)
- Richten Sie sichere Passwörter gemeinsam mit Ihrem Kind ein. Sie als Eltern führen die Passwortliste und sollten zum Schutz des Kindes immer Zugriff auf das (erste) Smartphone haben
- Legen Sie für Ihr Kind ein eigenes, mit Ihrem Konto verknüpftes Kinderkonto an: So erkennt das System Sie als Erziehungsberechtigten und ermöglicht Ihnen bestimmte Steuerungsfunktionen
- Bringen Sie Ihrem Kind bei, sich zu seinem Schutz möglichst anonym im Netz zu bewegen – ohne Klarnamen, echte Adresse oder genaues Geburtsdatum
- Stellen Sie die Möglichkeit Ihres Kinds, selbstständig „In-App-Käufe“ zu tätigen, aus
- Schalten Sie Funktionen aus, die Ihr Kind ablenken: zum Beispiel Geräusche bei neu eintreffenden Nachrichten
- Elternapps für Android und iOs: „family link“ und „Bildschirmzeit“: Dort können Sie für jede einzelne App Medienzeiten einstellen oder ab einer bestimmten Uhrzeit deren Nutzung blockieren.
Der nächste Vortrag findet am 10.12.2025 von 18:00-20:00 Uhr im Smart City Forum statt. Thema: „Social Media – TikTok, Insta & Co“